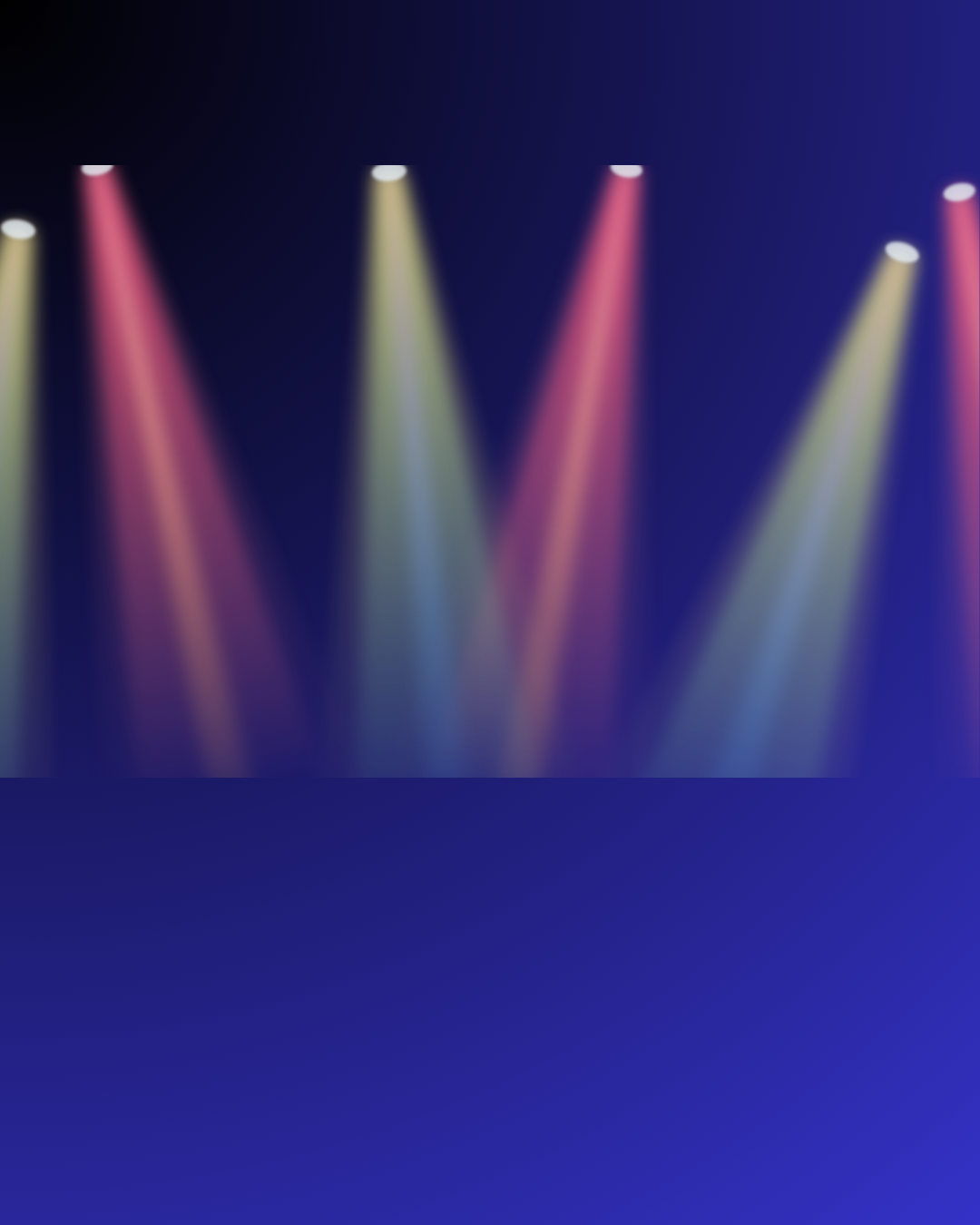Seit etwa 1 Jahr mache ich eine Weiterbildung zur Content Creatorin – ein Weiterbildungsprogramm, das in Wahrheit das Niveau eines Studiums hat. Warum ich das betone? Ganz einfach, weil die Gesellschaft oft annimmt, dass ich aufgrund meiner Behinderungen nichts leisten kann. Es heißt ständig, ich hätte „besondere Bedürfnisse“. Deshalb müsse ich ins Berufsförderungswerk für sehbehinderte und blinde Menschen gehen – eine spezielle Berufsschule, in der bereits vorgegebene Berufe unterrichtet werden. Dort stehen zwar Hilfsmittel für Sehbehinderte bereit, und die Ausbilder sind auf Sehbehinderung und Blindheit geschult, aber das reicht nicht aus.
Denn ich bin nicht nur sehbehindert – ich habe auch eine Sprachbehinderung und bin chronisch krank. Soll ich mich deswegen auf bestimmte Berufe einschränken lassen, nur weil meine gesundheitliche Situation es scheinbar vorgibt? Ich hasse es, wenn andere über meinen Kopf hinweg entscheiden wollen, was für mich richtig ist. Ich weiß selbst am besten, was ich leisten kann und was nicht.
Kampf um die Ausbildung als Content Creater
Vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal von der Ausbildung zur Content Creatorin im Internet gehört. Daraufhin habe ich beim Amt nachgefragt und die Unterlagen für diese Weiterbildung eingereicht. Doch was war die erste Reaktion? „Nicht zukunftsorientiert!“ Da fragt man sich wirklich: Wissen die nicht, dass sich heutzutage fast alles im Internet abspielt? Währenddessen habe ich weiter an meinem Account gearbeitet und nach anderen Lösungen gesucht – bis ich irgendwann die Chance bekam und Unterstützung fand. Schließlich konnte ich die Weiterbildung doch beginnen, weil jemand in mir Potenzial gesehen hat. Dennoch musste ich auf dem Weg dorthin viel Ableismus erleben.
Bei meiner Ausbildungsstelle habe ich direkt klargestellt, was meine Situation ist. Natürlich lief der Anfang holprig, aber schließlich wurde mir ein eigener Account eingerichtet, der barrierefrei für mich angepasst wurde. Und was ist daran so schwierig oder außergewöhnlich? Eigentlich gar nichts. Die meisten Funktionen sind heutzutage ohnehin schon in den Computer integriert. Künstliche Intelligenz hilft mir beispielsweise bei der Grammatik. Insgesamt bin ich zufrieden, weil ich in der Ausbildung kaum Ableismus erfahre. Trotzdem begegnet er mir hin und wieder – wenn auch oft in subtiler, versteckter Form.
Barrierefreiheit vs Perfektion
Alles beginnt mit dem Thema Perfektion. Aber was ist Perfektion überhaupt? Aufgrund meiner Behinderungen kann ich nicht immer alles perfekt machen, weil ich die Dinge anders angehen muss. Ich bin ständig damit beschäftigt, meine Behinderungen auszugleichen – selbst wenn ich barrierefreie Programme und Einstellungen in vielen Formen nutze. Jedes Mal, ob in einer Vorlesung vor Ort oder online, fängt mein Gehirn an zu arbeiten: „Wie soll ich das am besten umsetzen?“
Man hört immer wieder, dass bestimmte Programme in der Industrie genutzt werden – nur weil sie zahlreiche Funktionen und Spezialeffekte bieten. Aber ist das wirklich entscheidend? Ist es wichtiger, die spektakulärsten Features zu nutzen und dabei überfordert zu sein, oder sollten wir uns fragen: „Weniger ist mehr“? Einfachheit ist oft barrierefreier und dadurch effektiver.
KI eine Lösung?
Aber was ist mit der KI? Künstliche Intelligenz wird in Zukunft auch Teile des Handwerks ersetzen. Ich bin überzeugt, dass KI ein äußerst nützliches Werkzeug für Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt sein kann. Doch auch hier werden behinderte Menschen oft übersehen. Jede Weiterentwicklung eines Programms sollte mit Anpassungen für Barrierefreiheit einhergehen – ein entscheidender Punkt, der häufig ignoriert wird.
Durch diese Anpassungen könnten Menschen mit Behinderungen Zugang zu anderen Berufsfeldern erhalten, abseits der vorgegebenen „klassischen“ Berufe. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Leider wird Barrierefreiheit auf vielen Ebenen vergessen. Es gibt so viele Arbeitsbereiche, die Menschen mit Behinderungen erobern könnten, um ihre Perspektiven sichtbar zu machen. Doch in Deutschland ist der Weg dorthin noch lang.
Hinzu kommt, dass viele behinderte Menschen sich ihres eigenen Ableismus nicht bewusst sind. Das macht es umso schwieriger, aus dem „Gefängnis“ des bestehenden Systems auszubrechen. Hier liegt eine große Gefahr: ohne Veränderung bleiben wir in den Strukturen gefangen, die uns einschränken.
Wenn der eigene Ableismus dazu kommt?
Oft spüre ich meinen eigenen Ableismus und bin mir dessen bewusst. Ich möchte meine Prüfungsabgabe gut machen – mein oberstes Ziel ist es, zu bestehen. Bis jetzt habe ich das sehr gut hinbekommen, worauf ich stolz bin. Aber es gibt Momente, in denen ich mir selbst sagen muss: „Ich mache es eben anders.“ Auch wenn es mehr Schritte bedeutet. Aber ich kann das, auch wenn es für die Mehrheit nicht perfekt ist. Würde ich mir einreden, dass ich alles perfekt machen muss, hätte ich vieles nicht erreichen können. Stattdessen wäre ich in meinen eigenen Schatten gefallen.
Trotzdem signalisiert mir die Gesellschaft oft unterschwellig: „Du musst alles perfekt machen – auch mit deiner Behinderung.“ Hier greift das Leistungsprinzip. Gleichzeitig habe ich keine Lust, ständig zu erklären: „Hallo, ich bin behindert, und die Programme sind nicht optimal.“ An dieser Stelle treffen äußerer Ableismus und mein eigener aufeinander.
Das Problem liegt jedoch nicht nur an menschlichen Einstellungen, sondern auch an den starren Normen der Arbeitswelt. Ob im Internet, in den sozialen Medien oder in der „normalen“ Arbeitswelt – es wird ständig vergessen, dass niemand perfekt ist. Nicht einmal Maschinen sind perfekt; auch sie geben nach einer Weile nach.
Die Perfektion der Sozialen Medien
Was würde passieren, wenn die sozialen Medien und das Internet plötzlich ausfallen würden? Es gäbe einen großen Aufschrei – doch wer würde ihn wirklich hören? Die Menschen, die ständig ihre perfekten Figuren und verschönerte Welten präsentieren, wären auf einmal „weggecancelt“. Aber was ist mit den Minderheiten? Sie wurden schon immer irgendwo „weggecancelt“. Selbst wenn sie sich ein wenig Sichtbarkeit erkämpfen konnten, bleiben die Regeln der Plattformen oft diskriminierend und nicht barrierefrei.
Das Internet selbst ist in vieler Hinsicht ableistisch, weil es Perfektion verlangt. Um mit einem Bericht oder Post ein hohes Ranking zu erreichen, muss man sich den vorgegebenen Standards anpassen – Standards, die behinderte Menschen oft ausschließen. Dadurch wird ihre Sichtbarkeit stark eingeschränkt, obwohl sie im Verhältnis mehr Zeit im Internet verbringen als andere Gruppen.
Wir dürfen auch Raum einnehmen – nicht nur die anderen. Warum sollten wir das zulassen, dass unsere Perspektiven unsichtbar bleiben? Es ist an der Zeit, dass wir uns diesen Platz nehmen.
Unsichtbar mehrfachbehindert und aus dem System
Aufgrund meiner Hauptbehinderungen sind viele Dinge für mich sehr anstrengend. Manche würden jetzt sagen: „Dann lass es doch.“ Aber meine Antwort ist: „Nein. Denn es macht mir Spaß.“ Es kommt auf die richtige Abstimmung zwischen Behinderung und Barrierefreiheit an.
Gerade ich falle oft aus dem System heraus, weil ich nicht in die allgemeine Vorstellung von Behinderung passe – und ich spüre das ständig. Deshalb bin ich in vielen Situationen auf mich allein gestellt. Umso dankbarer bin ich, dass ich eine Ausbildungsstelle gefunden habe, an der auf meine Bedürfnisse geachtet wird. Trotzdem nehme ich hier und da versteckten Ableismus wahr, sei es durch Unwissenheit oder das Leistungsprinzip.
Dennoch muss ich sagen, dass diese Ausbildungsstelle im Vergleich zu anderen Bildungseinrichtungen, die ich erlebt habe, zu meinen Top 3 gehört. Und ich habe bereits einige Erfahrungen gesammelt.